Sprache macht den Menschen
Die Fähigkeit, Sprache erzeugen und verstehen zu können, macht den Menschen zu etwas Einzigartigem. Doch nicht nur Menschen, auch Affen und Hunde können Wörter lernen. Wo liegt er also, der entscheidende Unterschied zu unserer menschlichen Sprache? Und wie entwickelt sich eigentlich dieses Medium, in dem wir sprechen und schreiben, denken und dichten?
Von Angela D. Friederici, Michael Skeide und Verena Müller
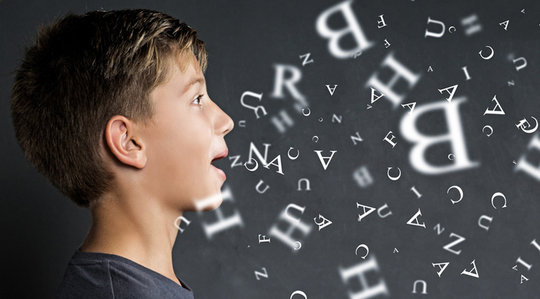 Bild vergrößern
Bild vergrößern
Sprache ist das, was den Menschen ausmacht. Zwar würden einige an dieser Stelle erwidern, dass auch andere Lebewesen miteinander kommunizieren. Stimmt. Tatsächlich können die verschiedenen Spezies auf vielfältige Weise miteinander Informationen austauschen. Sie können sogar einzelne Symbole oder Wörter als Bezeichnungen für verschiedene Dinge und Objekte lernen. Vor allem Hunde und Menschenaffen zeigen hier beeindruckende Fähigkeiten. Was sie dabei jedoch lernen, ist eine Assoziation zwischen einem bestimmten abstrakten Symbol oder einer akustischen Wortform und einem Objekt, zum Beispiel dem Begriff „Auto“ und einem realen PKW. Sie eignen sich also jedes „Wort“ durch Assoziationen einzeln an.
Wörter zu lernen, ist es also nicht, was menschliche Sprache ausmacht. Was ist es dann? Es ist die Gabe, Wörter nach bestimmten Regeln zu kombinieren. Denn lose aneinandergereihte Wörter ergeben noch keine Sprache. Erst, wenn sie nach einem festgelegten Regelwerk aneinander gefügt werden, ergeben sie eine Bedeutung. Menschaffen sind hingegen nicht in der Lage, grammatikalische Regeln zu lernen, die jenen einer Sprache entsprechen.
Nehmen wir zum Beispiel eine Liste an Wörtern. Schlafen, grün, farblos, wütend, Idee. Kombiniert nach den Regeln der deutschen Grammatik erhalten wir vielleicht den Satz „Farblose grüne Ideen schlafen wütend“. Dieser Satz ist zwar grammatikalisch richtig und lässt sich verarbeiten, weil er den Regeln der Sprache folgt. Einen Sinn ergibt er jedoch nicht. Denn es ist nicht nur wichtig, in welcher Reihenfolge wir die Wörter aneinander reihen. Entscheidend ist auch, wie wir diese interpretieren. Der Satzbau, die Syntax, ist somit nur ein Aspekt der Sprache. Ebenso wichtig ist auch die Bedeutung der einzelnen Wörter, die Semantik. Mit ein paar kleinen Änderungen können wir so auch diesem Satz einen Sinn verleihen: „Noch etwas farblose grüne Ideen schlafen wütend in meinem Kopf“ beispielsweise. Wie jeder nun diesen Satz für sich deutet, ist wiederum abhängig von seinem individuellen Wissen über die Bedeutung von Wörtern, das er in seinem sogenannten mentalen Lexikon des Gehirns gespeichert hat.
Vom Gebrabbel zu komplexen Sätzen
 Bild vergrößern
Bild vergrößern
Trotz dieser scheinbaren Grenzen, die unserer Sprache durch dieses Regelwerk gegeben werden, ist die Fülle an Möglichkeiten, aus Wörtern Sprache zu zaubern, unerschöpflich. So beeindruckend diese Unendlichkeit jedoch ist, so lang scheint auch der Weg, den unser Sprachsystem im Gehirn durchläuft, um zu voller Reife zu gelangen. Denn so verzückt Eltern auch sind, wenn ihr Kleines die ersten Wörter spricht – ob „Ma-Ma“ oder „Pa-Pa“ - so sehr wird in dem Moment auch deutlich, welche Quantensprünge es meistern muss, um später komplexe Sätze verstehen und interpretieren zu können. Einige dieser Sprünge sind in Windeseile erreicht, für andere braucht es viele Jahre.
So verfügen bereits Dreijährige über einen umfangreichen Fundus an Vokabeln und können einfache Sätze problemlos verstehen. „Der Fuchs jagt den Igel“ beispielsweise. Eine echte Hürde erreichen die Kleinen jedoch dann, wenn der Satz von seiner einfachsten Struktur abweicht. Will man beispielsweise hervorheben, dass es der Igel und nicht etwa ein Vogel ist, den der Fuchs da jagt, so stellt man die Aussage entsprechend um: „Den Igel jagt der Fuchs“. Missverständnisse sind dann vorprogrammiert. Denn junge Sprecher verlassen sich noch unbewusst auf die Annahme, dass das Subjekt, der jagende Fuchs, im Satz vor dem Objekt, dem gejagten Igel, steht. Andererseits registrieren Kinder schon unbewusst, dass der Artikel „den“ irgendwie nicht zum Subjekt passt, und nicht an den Anfang des Satzes gehört. Erst das erwachsene Gehirn kann die veränderte Reihenfolge der Satzbausteine mit Leichtigkeit verarbeiten.
Warum ist das so? Warum können wir zwar einerseits bereits im Mutterleib Vokale voneinander unterscheiden, andererseits jedoch frühestens im Alter von sieben Jahren grammatikalisch anspruchsvollere Sätze verstehen, selbst wenn sie sich aus einfachen Wörtern zusammensetzen?
Auch das Gehirn muss reifen
Kurz gesagt: Gut Ding will Weile haben. Das Gehirn und seine einzelnen, für die Sprache zuständigen Hirnareale reifen unterschiedlich schnell heran. Manche Areale verdichten erst nach und nach ihr Netzwerk zu anderen Regionen, sodass sie dann Informationen immer schneller und effektiver austauschen können.
Ein Gebiet, das von Anfang an, noch vor der Geburt vor Aktivität strotzt, ist die sogenannte Wernicke-Region im linken Schläfenlappen des Großhirns, die schon sehr früh in der Entwicklung ausgereift ist. Schon sehr früh hilft uns diese Hirnregion nicht nur dabei, in Höchstgeschwindigkeiten von 0,2 bis 0,5 Sekunden Laute wie „Ma“ und „Pa“ voneinander zu unterscheiden. Sie entscheidet für uns auch darüber, ob eine Aneinanderreihung von Silben überhaupt ein Wort darstellt und damit wert ist, sich ihr weiter zu widmen. Auch einfache Sätze aus wenigen Wörtern können hier bereits verarbeitet werden. Etwa bis zum dritten Lebensjahr ist die Wernicke-Region das Epizentrum unserer Sprache.
Erst ab diesem Alter gesellt sich nach und nach auch eine zweite zentrale Sprachregion dazu: Die Broca-Region im Stirnbereich unseres Großhirns, die sich vor allem der Verarbeitung komplizierterer Sprache widmet. Sie empfängt die vorsortierten Informationen aus dem Schläfenlappen und verleiht den einzeln aneinandergereihten Wörtern eine Gesamtbedeutung. Aus separaten Rohinformationen werden so sinnvolle Sätze gebaut. Indem sich auch hier die Neuronen mehr und mehr verdrahten, werden für uns mit zunehmendem Alter auch kompliziertere Formulierungen zur Leichtigkeit.
Wir können den erhöhten Schwierigkeitsgrad komplexer Sätze also zunehmend auch dadurch wettmachen, dass unser Broca-Areal stärker als bei einfachen Sätzen aktiviert wird. Doch nicht nur dadurch: Auch die Verbindungsbahn zwischen den beiden Hauptakteuren der Sprachverarbeitung, der Wernicke- und der Broca-Region, spielt eine entscheidende Rolle. Dieses Bündel Nervenfasern, der Fasciculus arcuatus, braucht besonders lange, um voll funktionstüchtig zu sein. Der Grund: Es bildet um jede seiner Fasern langsam eine dicke Myelinschicht. Das braucht zwar viele Jahre, ist dann aber umso wirkungsvoller. Denn ähnlich wie der Kunststoff um den Kupferdraht eines Stromkabels, sorgt das Myelin dafür, dass die elektrischen Signale mit möglichst wenigen Verlusten und in hoher Geschwindigkeit übertragen werden. Neueste Untersuchungen haben ergeben, dass schwierige Sätze umso schneller verarbeitet werden, je dicker die Myelinschicht um diese Hochgeschwindigkeitskabel ist. Dadurch können ungefähr erst mit Ende der Pubertät kompliziertere Formulierungen genauso schnell verarbeitet werden wie einfache – egal, ob der Igel als Objekt an erster oder letzter Stelle im Satz steht.
Dem Gehirn beim Sprechen zusehen
Diese Erkenntnisse haben wir in großen Teilen vor allem einem zu verdanken: Den neuen technischen Innovationen der letzten Jahre, insbesondere der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT). Durch sie können wir dem Hirn beinahe beim Sprechen zusehen. Indem sich das Verfahren die unterschiedlichen magnetischen Eigenschaften von sauerstoffarmem und –reichem Blut zunutze macht, zeigt es uns aktivierte sauerstoffdurchflutetet Hirnareale an. Das war ein großer Schritt, denn bis zu diesem Zeitpunkt konnte man Rückschlüsse über die Funktionsweise unseres Denkorgans hauptsächlich am Beispiel von Patienten mit spezifischen Ausfällen ziehen – und der Untersuchung ihres Gehirns nach ihrem Tod.
Und selbst nach Entwicklung dieser neuen Methoden, wurden sie bis vor kurzem fast ausschließlich auf Studien mit Erwachsenen beschränkt. Denn entscheidend für aussagekräftige Aufnahmen ist, dass die Probanden während des Sprachtests im Tomographen ihren Kopf nicht bewegen. Etwas, das Kindern bekanntermaßen besonders schwer fällt. Uns am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften ist es dennoch gelungen, Methoden weiterzuentwickeln, die uns – selbst bei Dreijährigen –einen Blick in das kindliche Gehirn erlauben, während es Sprache verarbeitet. Unsere Idee: Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Wir üben mit den Kleinen das Stillhalten, indem wir ihnen beispielsweise im Voraus einen Trickfilm zeigen, den sie ohne Unterbrechung sehen können, wenn sie dabei ihren Kopf ruhig halten. Und wenn der Trickfilm spannend ist, funktioniert das.
Sprachentwicklung – ein universelles Programm
Wie universell dieses biologische Programm ist – von der Schreiphase und der Lallphase über den Erwerb erster Wörter und syntaktischer Regeln bis hin zur Verarbeitung von komplexen Satzstrukturen – lässt sich besonders an Kindern bestaunen: Mühelos kann jedes Kind jede Sprache der Welt erlernen, in die es hineingeboren wird. Nach der Geburt ist es zunächst offen für jede Sprache, spezialisiert sich dann aber gemäß dem jeweiligen sprachlichen Umfeld. So erkennen in den ersten Lebensmonaten noch alle Kinder weltweit gleichermaßen lautliche Unterschiede, egal ob sie in der jeweiligen Muttersprache von Bedeutung sind oder nicht. Später können sie dann nur noch diejenigen auseinanderhalten, die in der eigenen Muttersprache relevant sind. Ein berühmtes Beispiel ist der Unterschied zwischen den Sprachlauten „r“ und „l“, der zwar im Deutschen entscheidend ist, um „Rast“ von „Last“ zu trennen, nicht aber im Japanischen. Deshalb geht bei Japanern die Fähigkeit verloren, diese Sprachlaute zu unterscheiden. In anderen Sprachen sind wiederum andere Laute ohne Bedeutung, sodass auch diese verloren gehen.
Das Medium, in dem wir also sprechen, lesen und schreiben, denken und dichten, mailen und twittern, ist letztlich ein spezifisch menschliches Natur- und Kulturprodukt komplex verschalteter Neuronenbündel. Ein Bündel, das sich zwar nach einem vorgegeben biologischen Programms entwickelt, dabei aber deutlich unter dem Einfluss unseres kulturellen Umfelds entsteht, in dem wir aufwachsen und leben. Nur wenn wir beides betrachten, den naturwissenschaftlichen und den geisteswissenschaftlichen Aspekt, wird ein tieferes Verständnis von Sprache möglich.











